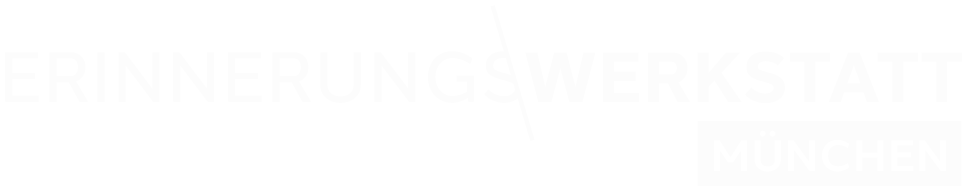Johann Baptist „Bapist“ Höllenreiner
Bapist Höllenreiner (Bild: Höllenreiner Familienbesitz)
Geboren am 25. Dezember 1938 in München
Deportiert am 13. März 1943 nach Auschwitz
Verstorben am 26. Dezember 2021 in Nürnberg
Herkunftsfamilie
Johann Baptist „Bapist“ Höllenreiner war das jüngste Kind von Konrad Höllenreiner (geboren am 28. März 1901 in Kitzingen, verstorben am 19. März 1985 in München) und Alma „Notschga“ Höllenreiner, geb. Hanstein (geboren am 21. März 1902 in Scheeßel/Niedersachsen, ermordet am 17. Juni 1943 in Auschwitz).
Seine Geschwister waren:
Ludwig „Lugi“ (geboren am 13. August 1929 , verstorben am 21. Oktober 2014 in München)
Maria „Lolitschai“ (geboren am 29. August 1931 in Oberweid, ermordet im April 1944 in Auschwitz)
Anna „Weichsla“ (geboren am 29. Dezember 1932 in München, ermordet im Februar 1945 in Ravensbrück/Jugendschutzlager Uckermark)
Werna „Musla“ (geboren am 25. Dezember 1935 in München, verstorben Ende April 1945 in Bergen-Belsen nach der Befreiung)
Kindheit in München-Giesing
Der Vater von Bapist Höllenreiner stammte aus einer großen, selbständigen Händlerfamilie. Er hatte zehn Geschwister. Zusammen mit seinen drei Brüdern Josef, Johann Baptist und Peter Höllenreiner führte er in München ein Fuhrunternehmen. Konrad Höllenreiner wohnte mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in der Deisenhofener Str. 79. Dort lebte auch ein weiterer Bruder von ihm namens Friedrich „Friedla“ Höllenreiner. Bapist hatte in Giesing eine schöne Kindheit. Nicht weit entfernt, in der Deisenhofener Str. 64, wohnte Josef Höllenreiner mit seiner Frau Sofie und ihren sechs Kindern.
1939 wurden durch die Polizei alle Pferde von Konrad und Josef Höllenreiner beschlagnahmt. Damit war den Familien ihre Einkommensgrundlage genommen worden. Konrad, seine Brüder und andere männliche Verwandte wurden ab 1940 zur Wehrmacht eingezogen. Die Familien lebten jetzt vom knappen Sold der Soldaten. Die Mutter von Bapist habe noch Ziegen und Hühner gehabt, so schreibt Hugo Höllenreiner in seinen Lebenserinnerungen. Im Dezember 1941 wurden sein Vater Konrad und alle anderen Sinti und Roma aus „Rassepolitischen Gründen“ aus der Wehrmacht entlassen. Anschließend wurden die erwachsenen Männer zu Pflasterarbeiten am Giesinger Berg zwangsverpflichtet.
Bapist Höllenreiner (rechts mit dem Holzpferd) mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Alma (Bild: Höllenreiner-Familienbesitz)
Verhaftung
Am 16. Dezember 1942 erließ Heinrich Himmler den sogenannten Auschwitz-Erlass. Das Dekret regelte in bürokratisch-rassistischer Diktion, dass die deutsche Minderheit der Sinti und Roma mit ihren Kindern ebenso wie die Juden deportiert und schließlich ermordet werden sollten.
Daraufhin umstellten am 8. März 1943 Polizeibeamte die Häuser der Sinti-Familien in der Deisenhofener Straße. Bapist wurde im Alter von vier Jahren, zusammen mit seinen Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten, verhaftet und ins Polizeipräsidium in der Ettstraße gebracht
Deportation nach Auschwitz-Birkenau
Am 13. März 1943 wurde Bapist, mit seiner Familie sowie dem größten Teil seiner Verwandtschaft, von München aus in das „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert. 134 andere Sinti und Roma befanden sich in diesem Transport, das war ein Großteil der etwa 200 Sinti und Roma, die damals in München lebten. Die Bedingungen des Transports waren katastrophal. Drei Tage waren die Menschen ohne ausreichend Wasser und Nahrung sowie ohne sanitäre Anlagen in Güterwagons eingesperrt.
Im Lager von Auschwitz-Birkenau
Bapist erhielt in Auschwitz die Nummer Z 3533. Sein Onkel Friedla Höllenreiner verstarb dort nach kurzer Zeit als erster aus der Familie.
Seit Ende Mai 1943 war Dr. Josef Mengele Lagerarzt in Auschwitz. Sein Labor befand sich im sogenannten „Zigeuner“ Familienlager. Er führte dort vor allem an Kindern der Sinti und Roma medizinische Versuche zu Forschungszwecken durch. Zunächst lockte er die Kinder mit großer Freundlichkeit und Süßigkeiten, sodass diese ihn „Onkel“ riefen. Danach führte er an ihnen verschiedene medizinische Versuche durch. Vor allem bei Zwillingen endeten diese häufig mit der Ermordung der Kinder. Anschließend wurden deren Organe zu Forschungszwecken nach Berlin geschickt. Auch an Bapist wurden von Dr. Mengele Versuche durchgeführt. Er erzählte, dass ihm ohne jede Indikation Drüsen entfernt wurden und dass er Spritzen im Rahmen medizinischer Experimente erhalten habe. Seine Töchter entdeckten bei seiner Pflege als alter Mensch unter seinem dichten Kopfhaar eine große Operationsnarbe. Bapist bestätigte, dass Dr. Mengele ihn ohne jede Indikation am Kopf operiert habe.
Am 17. Juni 1943 starb seine Mutter im Krankenrevier. Als Todesursache wurde Fleckfieber angegeben. Bapist war viereinhalb Jahre alt, als er seine wichtigste Bezugsperson verlor. Im April 1944 verstarb dann seine Schwester Lolitschai. Sie wurde so heftig mit einem Stock geschlagen, dass ihr das Blut aus dem Mund schoss, daran konnten sich Bapist und alle Verwandten erinnern.
Im Sommer 1944 wurde er mit seinen Tanten und den beiden Schwestern ins Frauenlager Ravensbrück deportiert. Sein Vater und sein großer Bruder kamen dort in das Männerlager. Anfang 1945 wurden alle Frauen und Mädchen sterilisiert, seine Schwester Weichsla ist an den Folgen der Operation verstorben. Sein Vater und sein Bruder wurden am 3. März 1945 nach Sachsenhausen deportiert.
Im März 1945 wurde Bapist Höllenreiner, mit seinen Tanten und seiner Schwester Musla, nach Bergen-Belsen transportiert. Bapist wurde dort mit seinen überlebenden Verwandten durch die britischen Truppen befreit. Er erinnerte sich, dass er einen süßen Riegel bekam und damit zu seiner Schwester lief, um ihr diesen zu bringen. Genau in diesem Moment bekam Musla einen Blutsturz, krampfte sich infolgedessen mit ihren Zähnen an der Bettstange fest und verstarb. Dieses und andere Erlebnisse aus den Konzentrationslagern konnte Bapist nie verarbeiten.
Sein älterer Bruder Lugi fuhr Ende April 1945 nach Bergen-Belsen und suchte nach Bapist. Bapist saß unter einem Baum und rief seinen Bruder mit Namen, denn Lugi hatte seinen kleinen Bruder nicht wieder erkannt. Bapist war halb verhungert und in einem katastrophalen Gesundheitszustand. Nachdem er nicht mehr laufen konnte, trug Lugi ihn, kletterte mit ihm über den Zaun und fuhr mit ihm nach München.
Kindheit nach 1945 in München
Bapist Höllenreiner verbrachte ca. zwei Jahre in einem Krankenhaus in München. Dort wurde er so gut wie es möglich war, gepflegt und behandelt. Anschließend war er in einem Kinderheim, wo er eine Erzieherin hatte, die wie eine Mutter zu ihm war und ihm immer ein Kinderlied vorsang. Mit ca. acht Jahren wurde er von seinem Vater Konrad Höllenreiner nach Hause geholt. Dort lebte außerdem sein großer Bruder Lugi und die neue Ehefrau seines Vaters, die ihn leider nicht gut behandelte.
Gründung einer Familie
Mit 19 Jahren heiratete er die zehn Jahre ältere Margareta „Gretl“ Höllenreiner, geboren als Margareta Höllenreiner, am 19. Mai 1928 in Neuhof an der Zenn. Bapist zog zu Gretl nach Nürnberg. Dort bekamen die beiden drei Töchter und einen Sohn, geboren in den Jahren 1959, 1960, 1964 und 1968.
Leben in Nürnberg
Bapist und Gretl Höllenreiner waren selbständige Händler für Haushaltswaren und Elektrogeräte. Die beiden haben in einer guten Ehe gemeinsam ihr Leben gestaltet. Es gab für Bapist, seine Frau und seine vier Kinder weiterhin viele Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen als Sintis.
Bapist Höllenreiner war ein Familienmensch, der sich sehr um seine Kinder kümmerte. In den 60er Jahren war es außergewöhnlich, dass ein Vater häufig seine Kinder wickelte, sie herumtrug, sie tröstete und mit ihnen auf den Spielplatz, ins Freibad und in den Tiergarten ging. Bapist war extrem hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Auch um seine Enkel kümmerte sich Bapist später intensiv. Er war jedoch sein Leben lang psychisch sehr belastet durch seine unvorstellbaren Erlebnisse und Erfahrungen in den verschiedenen Konzentrationslagern.
Am 8. August 2016 starb seine Ehefrau. Der Abschied von seiner Gretl fiel Bapist nach 57 Jahren Ehe sehr schwer. In den folgenden Jahren war seine Familie einschließlich seiner Enkel für ihn da. Bapist Höllenreiner verstarb am 26. Dezember 2021 in Nürnberg im Alter von 83 Jahren im Kreis seiner Familie.
Text: Bettina Gütschow
Quellen
Stadtarchiv München, Signatur: DE-1992-EWK-76-H-552.
Sarah Grandke: Höllenreiner, Alma und Konrad (publiziert am 08.02.2024), in: nsdoku.lexikon, hrsg. vom NS-Dokumentationszentrum München, URL: https://www.nsdoku.de/lexikon/artikel/hoellenreiner-alma-und-konrad-361.
Interview am 28.2.2025 mit zwei Töchtern von Johann Baptist Höllenreiner.
Internet:
http://www.zeitzeugen-projekte.de/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=115, aufgerufen am 13.08.2024.
https://www.sintiundroma.org/de/set/022641/?id=2596&z=39, aufgerufen am 13.08.2024.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/4083778, aufgerufen am 13.08.2024.
Literatur:
NS Dokumentationszentrum München: Die Verfolgung der Sinti und Roma in München und in Bayern, hrsg. von Winfried Nerdinger, Metropol Verlag Berlin 2016.
Eiber, Ludwig: „Ich wusste, es wird schlimm". Die Verfolgung der Sinti und Roma in München 1933–1945, München 1993, S. 103f.
Tuckermann, Anja: „Denk nicht, wir bleiben hier!“ Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner, dtv, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2008