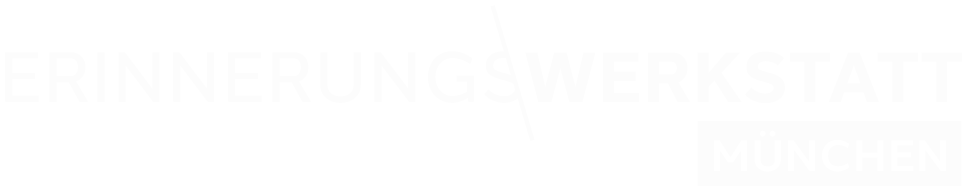Friedrich „Friedla“ Höllenreiner
Geboren am 17. September 1905 in Memmelsdorf bei Bamberg
Deportiert am 13. März 1943 nach Auschwitz
Ermordet am 24. März 1943 in Auschwitz-Birkenau
Herkunft
Friedrich „Friedla“ Höllenreiner wurde am 17. September 1905 in Memmelsdorf bei Bamberg geboren. Seine Eltern waren Johann Baptist Höllenreiner und dessen Frau Ottilie Höllenreiner, geb. Mettbach (1867-1938). Sie lebten in den dreißiger Jahren in Giesing in der Untersbergstrasse und gehörten zu einer bekannten Münchner Sinti Familie. Friedrich hatte fünf Schwestern und fünf Brüder. Vier seiner Brüder hatten gemeinsam ein Fuhrunternehmen.
Leben in München-Giesing
Friedrich Höllenreiner war ab 1. März 1932 in München gemeldet. Er wohnte bei seinen Eltern und arbeitete als Händler. Friedrich Höllenreiner war nicht verheiratet und hatte vermutlich keine Kinder. Inwieweit er mit einer Frau namens Anna zusammen lebte, lässt sich nicht mehr herausfinden. Ab dem 15. Mai 1939 zog er in die Deisenhofener Strasse 79, wo auch sein Bruder Konrad mit seiner Frau Alma und fünf Kindern lebte.
Ab 1940 wurde Friedrich Höllenreiner, ebenso wie seine Brüder, zur Wehrmacht eingezogen.1941 wurde er aus der Wehrmacht entlassen. Dies geschah vermutlich aufgrund der Verordnung des Oberkommandos der Wehrmacht, vom Februar 1941, wonach aus „Rassepolitischen Gründen“ alle „Zigeuner“ und „Zigeunermischlinge“ entlassen werden mussten.
Anschließend wurden die erwachsenen Männer aus den Sinti- und Romafamilien zwangsverpflichtet, für die Stadt in Giesing Pflasterarbeiten durchzuführen. Nach Hugo Höllenreiners Erinnerungen haben sie dafür nur die Hälfte des eigentlichen Lohns erhalten.
Verhaftung
Am 16. Dezember 1942 erließ Heinrich Himmler den sogenannten Auschwitz-Erlass. Das Dekret regelte in bürokratisch-rassistischer Diktion, dass die deutsche Minderheit der Sinti und Roma mit ihren Kindern, ebenso wie die Juden, deportiert und schließlich ermordet werden sollten.
Daraufhin umstellten am 8. März 1943 Polizeibeamte die Häuser der Sinti- und Roma-Familien und verhafteten sie. Auch Friedrich Höllenreiner, Alma und Konrad Höllenreiner mit ihren Kindern sowie ein Großteil der Verwandtschaft wurden verhaftet und in das Polizeipräsidium in der Ettstraße gebracht. Ihr Besitz wurde zugunsten des Staates eingezogen. In Friedrich Höllenreiners Akte bei der Oberfinanzdirektion wurde angegeben, dass er zu diesem Zeitpunkt keinerlei Vermögen oder Wertgegenstände besaß.
Deportation
Am 13. März 1943 wurde Friedrich Höllenreiner, gemeinsam mit 134 anderen Sinti und Roma aus München, in das “Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie am 16. März 1943 ankamen. Es war ein Großteil der etwa 200 Sinti und Roma, die damals in München lebten. Die Bedingungen des Transports waren katastrophal. Drei Tage waren die Menschen ohne ausreichend Wasser und Nahrung sowie ohne sanitäre Anlagen in Güterwagons eingesperrt.
Tod im “Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau
Friedrich Höllenreiner verstarb dort als erster aus der Familie innerhalb kurzer Zeit vermutlich an Fleckfieber.
Sein Bruder Konrad Höllenreiner stellte beim Amtsgericht München einen Antrag auf die Todeserklärung von Friedrich Höllenreiner sowie seiner Frau Alma und seiner drei Töchter. Seine beiden Brüder, Joseph und Johann Höllenreiner, bestätigten Friedrich Höllenreiners Tod durch eine eidesstattliche Erklärungen beim Amtsgericht München. Sie gaben an, seine Leiche gesehen zu haben.
Auf der Sterbeurkunde, die 1972 durch das Sonderstandesamt Arolsen ausgestellt wurde, wird als Todesdatum der 24. März 1943 angegeben.
Text: Bettina Gütschow
Quellen
Stadtarchiv München: Einwohnermeldekarte Signatur: DE-1992-EWK-76-H-552.
Staatsarchiv München OFD München 7851.
Staatsarchiv München, Amtsgerichte 104246.
Internet:
https://stadtgeschichte-muenchen.de/denkmal/gedenkorte/d_gedenkorte.php?id=953, aufgerufen am 16.12.2024.
Literatur:
NS Dokumentationszentrum München: Die Verfolgung der Sinti und Roma in München und in Bayern, hrsg. von Winfried Nerdinger, Metropol Verlag Berlin 2016.
Tuckermann, Anja: „Denk nicht, wir bleiben hier!“ Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner, dtv, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2008.
Eiber, Ludwig: „Ich wußte es wird schlimm". Die Verfolgung der Sinti und Roma in München 1933–1945, München 1993.