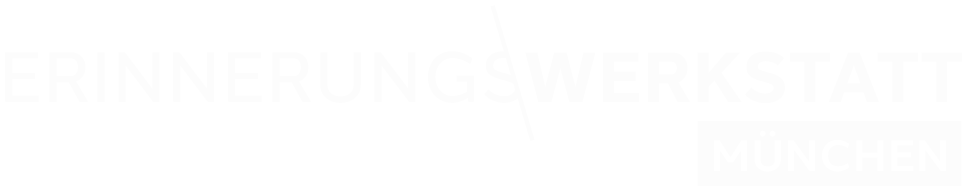Alma „Notschga” Höllenreiner, geb. Hanstein
Alma Höllenreiner (Bild: Höllenreiner-Familienbesitz)
Geboren am 21. März 1902 in Scheeßel/Niedersachsen
Deportiert am 13. März 1943 nach Auschwitz
Ermordet am 17. Juni 1943 in Auschwitz
Alma Hanstein „Notschga“ wurde am 21. März 1902 in Scheeßel, das ist ein kleiner Ort zwischen Hamburg und Bremen, geboren. Ihr Vater war Karl Hanstein, ihre Mutter Augusta Hanstein, geborene Grünholz. Als Wohnort der Eltern wird auf der Sterbeurkunde von Alma, datiert auf den 24. Juni 1943, Berlin angegeben. Über Geschwister ist bisher nichts bekannt.
Gründung einer Familie
1927 heiratete sie standesamtlich Konrad Höllenreiner, der am 28. März 1901 in Kitzingen geboren wurde und am 19. März 1985 in München verstorben ist. Seine Eltern waren Johann Baptist Höllenreiner und Ottilie Höllenreiner, geb. Mettbach. Sie gehörten zu einer großen Sinti Familie.
Ihre Kinder waren:
Ludwig „Lugi“ (geboren am 13. August 1929, verstorben am 21. Oktober 2014)
Maria „Lolitschai“ (geboren am 29. August 1931 in Oberweid - ermordet am 20. April 1944 in Auschwitz)
Anna „Weichsla“ (geboren am 29. Dezember 1932 in München, ermordet am 16. Februar 1945 in Ravensbrück/Jugendschutzlager Uckermark)
Werna „Musla“ (geboren am 25. Dezember 1935 in München- verstorben Ende April 1945 in Bergen-Belsen, nach der Befreiung)
Johann Baptist „Bapist“ (geboren am 25. Dezember 1938, verstorben am 26. Dezember 2021 in Nürnberg)
Alma Höllenreiner mit ihren Kindern (Bild: Höllenreiner-Familienbesitz)
1931 zog das Ehepaar mit ihren beiden Kindern Ludwig und Maria nach München in die Deisenhofener Straße 79. Konrad Höllenreiner hatte hier, zusammen mit seinen drei Brüdern Josef, Johann Baptist und Peter, ein Fuhrunternehmen. Zwischen 1932 und 1938 wurden die Töchter Anna und Werna sowie der Sohn Johann Baptist geboren.
Hugo Höllenreiner schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass 1939 durch die Polizei alle Pferde von Konrad und Alma beschlagnahmt wurden, ebenso die Pferde von Hugos Vater Josef. Josef war ein Bruder von Konrad und lebte mit seiner Frau Sofie und seinen sechs Kindern in der Deisenhofener Straße 64.
Damit war den Familien ihre Einkommensgrundlage genommen worden. Konrad Höllenreiner, seine Brüder und die anderen männlichen Verwandten wurden ab 1940 zur Wehrmacht eingezogen. Die Familien lebten jetzt vom knappen Sold der Soldaten. Alma habe noch Ziegen und Hühner gehabt, so Hugo Höllenreiner.
Im Februar 1941 ordnete das Oberkommando der Wehrmacht aus „Rassepolitischen Gründen“ den Ausschluss aller „Zigeuner“ und „Zigeunermischlinge“ an. Nach ihrer rassenbiologischen Erfassung wurden Soldaten, die Sinti und Roma waren, aus der Wehrmacht entlassen. Hugo Höllenreiner schreibt, dass die erwachsenen Männer anschließend zwangsverpflichtet wurden, für die Stadt zu arbeiten. Sie mussten den Giesinger Berg pflastern und haben dafür nur die Hälfte des Lohns erhalten.
Verhaftung
Am 16. Dezember 1942 erließ Heinrich Himmler den sogenannte Auschwitz-Erlass. Das Dekret regelte in bürokratisch-rassistischer Diktion, dass die deutsche Minderheit der Sinti und Roma mit ihren Kindern, ebenso wie die Juden, deportiert und schließlich ermordet werden sollten.
Daraufhin umstellten am 8. März 1943 Polizeibeamte die Häuser der Sinti und Roma Familien und verhafteten sie. Auch Alma und Konrad Höllenreiner wurden mit ihren Kindern sowie einem Großteil ihrer Verwandtschaft verhaftet und ins Polizeipräsidium in der Ettstraße gebracht. Ihr Besitz wurde zugunsten des Staates eingezogen.
Deportation
Am 13. März 1943 wurde Familie Höllenreiner, gemeinsam mit 134 anderen Sinti und Roma aus München, in das „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie am 16. März 1943 ankamen. Es war ein Großteil der etwa 200 Sinti und Roma, die damals in München lebten. Die Bedingungen des Transports waren katastrophal. Drei Tage waren die Menschen, ohne ausreichend Wasser und Nahrung sowie ohne sanitäre Anlagen, in Güterwagons eingesperrt.
Tod in Auschwitz-Birkenau
Friedrich „Friedla“ Höllenreiner, der Bruder von Konrad, verstarb in Auschwitz-Birkenau im April 1943 als Erster vermutlich an Fleckfieber. Alma „Notschga“ Höllenreiner starb am 17. Juni 1943 ebenfalls an Fleckfieber, im Alter von 41 Jahren, im Krankenrevier. Von da an kümmerten sich ihre Schwägerinnen um ihre drei Töchter und um ihren kleinen Sohn. Im Frühjahr 1944 verstarb ihre Tochter Maria „Lolitschai“. Sie wurde so heftig geschlagen, dass ihr das Blut aus dem Mund schoss, so erinnert sich Hugo Höllenreiner. Ende Juli 1944 wurden die Schwägerinnen von Alma mit den Kindern nach Ravensbrück deportiert. Nach Hugo Höllenreiner wurden dort Anfang 1945 alle Frauen und Mädchen sterilisiert, Anna „Weichsla“ sei daraufhin an den Folgen verstorben. Im März 1945 wurde die noch lebenden Familienmitglieder nach Bergen-Belsen transportiert. Werna „Musla“ starb dort Ende April 1945 kurz nach der Befreiung.
Konrad Höllenreiner und die beiden Söhne überlebten. Konrad stellte am 29. August 1957, beim Amtsgericht München, einen Antrag auf die Todeserklärung seiner Frau, seines Bruders Friedrich Höllenreiner und seiner drei Töchter. Vier seiner Brüder und zwei seiner Schwägerinnen bestätigten eidesstattlich, dass sie das Sterben dieser fünf Personen miterlebt haben. In den Akten des Amtsgerichts München finden sich berührende Beschreibungen: Aufgrund der Aussagen der überlebenden Verwandten wurden am 25. November 1957, vom Sonderstandesamt Arolsen, Sterbeurkunden für die Toten ausgestellt.
Text und Recherche
Bettina Gütschow
Quellen:
Staatsarchiv München, Amtsgerichte 104246
Onlinequellen:
Sarah Grandke: Höllenreiner, Alma und Konrad (publiziert am 08.02.2024), in: nsdoku.lexikon, hrsg. vom NS-Dokumentationszentrum München, URL: https://www.nsdoku.de/lexikon/artikel/hoellenreiner-alma-und-konrad-36.
http://www.zeitzeugen-projekte.de/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=115, aufgerufen am 13.08.2024.
https://www.sintiundroma.org/de/set/022641/?id=2596&z=39, aufgerufen am 13.08.2024.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/4083778, aufgerufen am 13.08.2024.
Literatur:
NS Dokumentationszentrum München: Die Verfolgung der Sinti und Roma in München und in Bayern, hrsg. von Winfried Nerdinger, Metropol Verlag Berlin 2016.
Eiber, Ludwig: „Ich wußte es wird schlimm". Die Verfolgung der Sinti und Roma in München 1933–1945, München 1993, S. 103f.
Tuckermann, Anja: „Denk nicht, wir bleiben hier!“ Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner, dtv, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2008.