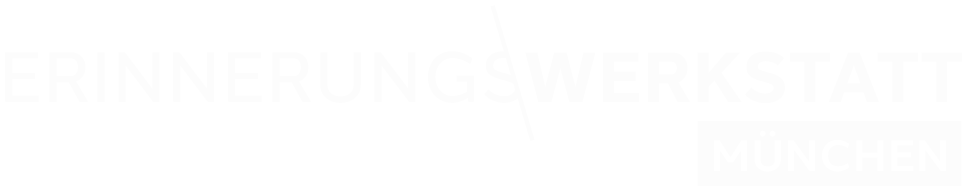Friedrich (Johann) Löh
Geboren am 2. November 1906 in Wassertrüdingen
Inhaftiert am 28. August 1937 im Konzentrationslager Dachau
Ermordet am 17. Februar 1942 in Hartheim
Friedrich Johann Löh wurde am 2. November 1906 in Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, geboren. Seine Eltern waren Friedrich Johann und Anne Marie Löh, geborene Stähle. Er hatte einen Bruder namens Albert Löh. Über seine Kindheit sowie über weitere Geschwister ist nichts bekannt. Als Beruf wurde in den Akten Gärtner und Gelegenheitsarbeiter angegeben.
Tätigkeit als Wanderarbeiter
Friedrich Löh verließ als ca.15 jähriger sein Elternhaus.
Anhand seines Strafregisters lassen sich einige Aufenthaltsorte rekonstruieren: 1921 Nördlingen, 1922 München und Monheim, 1923 Karlsruhe. Von 1925-1927 hielt er sich wieder in München auf, er war dort auch Mitglied der SA im Trupp Neuhausen.Danach trat er für ca. 5 Jahre in die französische Fremdenlegion ein. Ab März 1933 kehrte er zurück nach Deutschland, am 1. März wurde er Mitglied der NSDAP.
Sein Strafregister beinhaltet von 1921-1927 elf Verurteilungen wegen Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Bettelei. Seine Gefängnisstrafen waren von 3 Tagen bis zu 4 Monaten lang.
Niederlassung in München und neues Strafverfahren
Friedrich Löh war in München, Lothringer Str. 12 gemeldet. Er wurde von seinem Bruder Albert Löh unterstützt und konnte sich daher auf dessen Wohnung anmelden.
Im Oktober 1934 wurde Friedrich Löh von der Parteimitgliedschaft bei der NSDAP ausgeschlossen. Nach seinen eigenen Angaben geschah dieses wegen seiner Interesselosigkeit. Ebenfalls 1934 wurde seine uneheliche Tochter geboren, zu welcher er nie einen Kontakt haben konnte.
1935 kam es zu einem neuen Strafverfahren. Dieses Mal vor dem Sondergericht München, welches Vergehen aufgrund des sogenannten Heimtückegesetzes vom 20. Dezember 1934 behandelte.
Friedrich Löh hatte am 3. Januar 1935 in der Hans-Sachs-Straße versucht, sein NSDAP Parteiabzeichen, welches er illegal nach seinem Parteiausschluss behalten hatte, für ein paar Pfennige zu verkaufen. Seine Motivation dazu sei Hunger und völlige Mittellosigkeit gewesen. Friedrich Löh gab im Gerichtsverfahren an, dass er aufgrund von Krankheit nicht arbeiten konnte.
Er wurde zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Begründung war Bettelei in Verbindung mit der illegalen Verwendung seines Parteiabzeichens. Die Grundlage hierfür bildete das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen. Dieses Gesetz vom 20. Dezember 1934 stellte die missbräuchliche Benutzung von Abzeichen und Parteiuniformen unter Strafe.
Am 13. April 1935 erhielt er die Ladung zum Strafantritt in St. Georgen Bayreuth.
Nach der Entlassung aus dem Gefängnis kehrte Friedrich Löh nach München zurück.
Einweisung in die Fürsorgeeinrichtung Herzogsägmühle
Die Zwangsfürsorge und die Ausgrenzung vermeintlich „Gemeinschaftsfremder“ waren ein zentraler Baustein nationalsozialistischer Ideologie und Praxis für die Etablierung der „Volksgemeinschaft“. Repression und Verfolgung, die die als „asozial“ und „kriminell“ stigmatisierten Menschen erfuhren, geschah u.a. durch Zwangssterilisierungen, Entmündigungen sowie durch Einweisungen in Fürsorgeanstalten, Arbeitshäuser, Gefängnisse und Konzentrationslager.
Friedrich Löh wurde am 4. August 1937, durch das Polizeipräsidium München, gegen seinen Willen in die Zwangsfürsorgeanstalt Herzogsägmühle bei Peiting eingewiesen.
Ohne Arbeit, aufgrund von Krankheit, wegen seiner Vorstrafen und seinem nicht angepassten Lebensstil galt Friedrich Löh als fürsorgebedürftig. Der zuständige Amtsarzt von Schongau, Dr. Weiß, hielt fest, er sei ein „[…] schwerer Simulant und Psychopath Arbeitsscheu! […] Wenn auch eine Nervenerkrankung geringen Grades vorhanden ist, so handelt es sich bei Löh doch um einen schweren Psychopathen, der durch Übertreibung Arbeitsunfähigkeit vortäuschen will“. Er wurde als nicht vermittelbar eingestuft. Das Bezirksamt Schongau erließ daraufhin am 20. August 1937 einen Schutzhaftbefehl. Gegen diesen war grundsätzlich kein Einspruch möglich. In diesem Schutzhaftbefehl wurde Friedrich Löh als frech, aufdringlich, arbeitsscheu, mehrfach vorbestraft und als nicht einsichtig beschrieben. Damit stelle er eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung dar und konnte, aufgrund der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, vom 28. Februar 1933, in Haft genommen werden.
Inhaftierung im Konzentrationslager Dachau
Am 28. August 1937 wurde Friedrich Löh als sogenannter Schutzhäftling ins Konzentrationslager Dachau überstellt. Er erhielt verschiedene Häftlingsnummern, zunächst 399, danach 36046 und als letzte 19137. Auf seiner Häftlingskarte aus dem Konzentrationslager Dachau sind nach dem 28. August 1937 verschiedene andere Zugangsdaten notiert: 9. Mai 1939, 18. Februar 1940, 3. September 1940.
Vom 16. September 1940 gibt es eine Transportliste vom Konzentrationslager Sachsenhausen nach Dachau, so dass seine Ankunft in Dachau mit dem 17. September 1940 angegeben wird. Das bedeutet, dass Friedrich Löh zwischenzeitlich in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht und dann wieder zurück nach Dachau transportiert wurde.
Ermordung im Schloss Hartheim
Am 17. Februar 1942 wurde Friedrich Löh von Dachau in die NS-Tötungsanstalt Hartheim deportiert und anschließend dort in der Gaskammer des Schlosses ermordet. Vom 15. Januar 1942 bis 3. März 1942 gab es 15 Transporte mit insgesamt 1.452 Häftlingen aus dem Konzentrationslager Dachau nach Hartheim. Nach Selektionen wurden jeweils 100-120 nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge als sogenannte „Invalidentransporte“ ungefähr zweimal wöchentlich mit zwei LKWs dorthin gefahren und anschließend ermordet. Die Maßnahme lief unter der Bezeichnung „Sonderbehandlung 14f13“ oder „Aktion 14f13“.
Die Sterbeurkunde von Friedrich Löh, ausgestellt am 7. Mai 1942 in Dachau, gab als Sterbedatum den 29. April 1942 an. Bei dieser Falschbeurkundung handelte sich es um die übliche Vorgehensweise bei Morden im Rahmen der „Aktion 14f13“. Als Todesursache wurde ein Herz-Kreisverlauf-Versagen bei einer Lungenentzündung genannt. Damit sollte seine Ermordung durch Gas im Schloss Hartheim verschleiert werden.
Text und Recherche
Bettina Gütschow
Quellen
Staatsarchiv München, Staatsanwaltschaften 7905 (Akte des Sondergerichts München).
Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Nürnberg (LAELKB), Archiv Herzogsägmühle, Insassenakte Friedrich Löh Zentralwanderhof Herzogsägmühle.
Bundesarchiv Berlin, Signatur BArch_R_9361-IX_KARTEI_26230701 Löh, Friedrich.
Internetquellen
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/10181278 Sterbeurkunde.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130429151 Zugang KZ Dachau 1937.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/4090981 Transport vom KZ Sachsenhausen nach Dachau, September 1940.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/10697895 Häftlingskarte KZ Dachau.
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130430605 Zugang KZ Dachau 1940.
https://www.nsdoku.de/lexikon/artikel/loeh-friedrich-246, zuletzt aufgerufen am 20.02.2025.
Literatur:
Gedenkbuch für die Münchner Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“- Morde, Herausgeber: Michael von Cranach, Annette Eberle, Gerrit Hohendorf, Sibylle von Tiedemann, 2018.
Zeichen gegen das Vergessen! Gedenk-Buch in Leichter Sprache für die Opfer und Verfolgten in Herzogsägmühle in der Zeit von 1934 – 1945, Herausgeber: Diakonie Herzogsägmühle mit Annette Eberle und Babette Gräper, 2020.