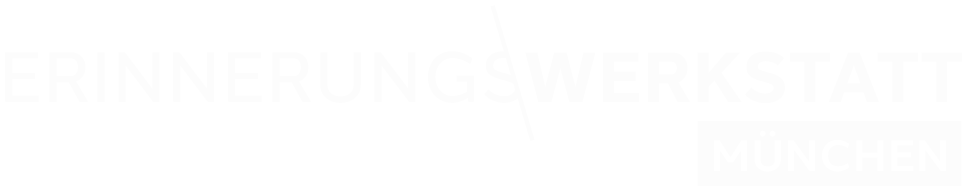Mahnmal für die Opfer der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938
Mahnmal, Foto: privat
Abseits der bekannten „Orte des Erinnerns und Gedenkens“ in der Münchner Innenstadt findet man am Isarhochufer, Ecke Isenschmidstraße/Hochleite eine Skulptur. Mitten auf einer von zwei alten Eichen mit blühendem Efeu, einer hohen Fichte, zwei Buchen und einer Birke teilweise beschatteten Wiese, steht die Skulptur „Pogromnacht 1938“ des Untergiesinger Künstlers Hans Martin Kieser. Errichtet wurde sie zum 80. Jahrestag der Pogromnacht, am 9. November 2018, auf Initiative von Melly Kieweg, aus Mitteln des Bezirksausschusses 18 Untergiesing-Harlaching. Die Skulptur aus rostendem und nicht rostendem Stahl wirkt etwas verloren auf der relativ großen Wiese und erschließt sich den zahlreich Vorübergehenden nicht auf den ersten Blick. Aus einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 12. November 2018 ist zu erfahren, dass der Künstler, der sonst eher heitere Figuren erschafft, den Auftrag gern, aber nicht ohne Bedenken annahm und das Konzept über Monate im Dialog mit dem Bezirksausschuss entwickelt hat.
Wer sich Zeit nimmt, kann auf einer Tafel diese Erklärung lesen:
„Komprimierte Schichtungen im Sockel zeigen die Geschichte der Menschheit, ihrer Kulturen, ihrer Religionen. Bildhafte Symbole stehen für ihre gemeinsame Entwicklung. Die Mitte der Stele benennt Gegenkräfte: Unterdrückung, Zerstörung, Vernichtung. Oben dann symbolisiert im Verwahrlosen, dem Zerstörerischen. In der Spitze hinfällig, dem Tod geweiht, sich selber vernichtend.“
Bild: Hans Martin Kieser
Bei genauer Betrachtung sieht man im oberen Teil der 1,70 Meter hohen und 55 cm im Quadrat messenden Skulptur zwei massive Stahlplatten. Von der unteren Platte bis zum Boden sind gefaltete, rostende Bleche wie ein Vorhang zu sehen, auf deren vier Seiten verschiedene Aspekte aus der Entwicklung der Menschheit auf Spruchbändern zu lesen sind. Die obere Stahlplatte ist leicht geknickt und erdrückt darunter liegendes jüdisches Leben, symbolisiert durch Menschen auf der Flucht, einen brennenden Tempel, einen verbogenen siebenarmigen Leuchter und Rollen, die von vorn wie Thorarollen anmuten und seitlich die Namen „Kafka, Meyerbeer, Zweig, Oppler und Lassalle“ tragen. Nur dieser Teil der Skulptur ist in hellem Edelstahl ausgeführt. An der Spitze, auf der geknickten Stahlplatte, sitzt eine übermächtige und gleichzeitig zerstört wirkende Figur mit einem Helm aus verrostetem Stahl auf dem Kopf.
Seit Kurzem steht auch ein informativer Flyer des Künstlers zur Verfügung, der die vielschichtige und ausdrucksstarke Skulptur näher erklärt.
Seit 2020 lädt die Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Leben“ jedes Jahr im November zu einer Gedenkfeier mit Kranzniederlegung ein. Diese Veranstaltung findet lokal Beachtung, aber aufgrund der großen Bedeutung der Pogrome vom 9. November 1938 für unzählige Münchner Juden, wäre eine breitere Beteiligung der ganzen Münchner Stadtgesellschaft wünschenswert. Der Befehl für die massive Gewalt gegen Juden deutschlandweit ging von einer Versammlung der NSDAP im Alten Münchner Rathaus, am Abend des 9. November 1938, aus und markiert den Übergang von der Diskriminierung und Entrechtung seit 1933 zu systematischer Vertreibung und letztlich Vernichtung aller Juden. Dieses Gedenken ist deshalb von besonderer Bedeutung für die ganze Stadt und eine Mahnung an uns alle.
Stellvertretend für die verfolgten Juden aus dem Viertel wurde bei der Einweihung am 10. November 2018, von Schülern des Theodolinden Gymnasiums, an das Schicksal von Karl Adler und Ernst Karl Henle erinnert. Karl Adler wurde am 22. November 1938 im Konzentrationslager Dachau ermordet, der frühere Stadtbaudirektor Ernst Karl Henle nahm sich am 11. November 1938 das Leben. Laut Polizeiakte: „Wollte der Familie nicht hinderlich sein, da Jude“ (aus dem Bericht der SZ vom 12.11.2018).
Gedenkfeier 2024: von links Rikki Reinwein, Dr. Herbert Dandl mit seinem neu erschienenen Buch „Jeder Mensch hat einen Namen“ (Gedenkbuch für die Opfer der Shoah aus Giesing und Harlaching), Melly Kieweg (Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben)
Autor:
Maria Faltermaier-Temizel
Quellen:
Süddeutsche Zeitung vom 12. November 2018
Internetquellen: